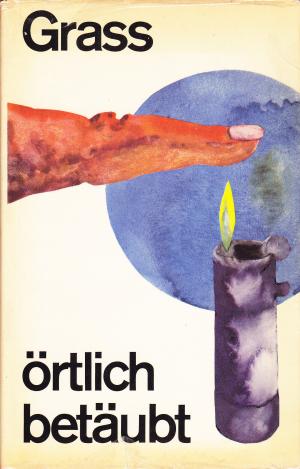Ein seltsames schmales Büchlein fiel mir unlängst in die Hände: das Cover in alarmistischem Gelb, geziert von einem zerzausten roten Katzenköpfchen. Darüber die Aufschrift: “Claude Cueni / Weisser Lärm / Roman / Alptraum vom Grossen Bruder”. Die Fischer-Taschenbuchausgabe (1983) eines Werks, das ursprünglich 1981 beim Aarauer Sauerländer-Verlag erschienen ist.

Der Autor Claude Cueni ist kein Unbekannter. Vor zwei Jahren verschaffte ihm der autobiographische Roman “Script Avenue”, in welchem er unter anderem vom Tod seiner grossen Liebe, von traumatischen Jugenderlebnissen und von seiner eigenen Krebserkrankung erzählt, eine grosse Medienpräsenz. Bekanntheit hatte der 1956 geborene Basler freilich schon zuvor: verschiedene historische Romane, beispielsweise die grosse Trilogie zur Geschichte des Geldes (“Cäsars Druide”, 1,998 “Das grosse Spiel”, 2006, “Gehet hin und tötet”, 2008), waren Bestseller. Des Weiteren arbeitete Cueni als Verfasser von Drehbüchern für diverse deutsche Krimiserien, etwa Peter Strohm und Eurocops. Was hingegen seine frühesten Romane betrifft, so scheinen diese weitgehend der Vergessenheit anheim gefallen zu sein.
Mindestens im Falle von “Weisser Lärm” vollkommen zu Unrecht. In diesem Frühwerk wird nicht die Vergangenheit, sondern eine mögliche Zukunft in den Blick gefasst. Es handelt sich dabei, wie der Orwell anrufende Untertitel schon andeutet, um eine klassische Dystopie, wie sie mir in dieser Ausprägung aus der Schweizer Literatur sonst nicht bekannt ist. Dystopie im helvetischen Literaturschaffen, das heisst vielfach nebelverhangene Bergstollen-Apokalypse: es sei etwa verwiesen auf Dürrenmatts “Der Winterkrieg in Tibet” (1981), Krachts “Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten” (2008) und in Ansätzen Burgers “Die künstliche Mutter” (1982) und . Cueni aber lässt uns eintauchen in einen beängstigenden Überwachungsstaat faschistoider Provenienz.
Die Hauptfigur Gustav Bender ist neunundzwanzig Jahre jung, arbeitet als Werbetexter bei der Adler Werbeagentur AG, lebt einsam und zurückgezogen mit seinem Kätzchen Sara in einer heruntergekommenen Wohnung. Als er eines Morgens mit dem unbestimmten Gefühl aufwacht, von einer todbringenden Krankheit befallen zu sein, und seinen Schwager, den Arzt Dr. Habicht, aufsucht, nehmen schreckliche Dinge ihren Lauf. Weil Bender aufgrund einer von irgendwelchen Obrigkeiten, deren genaue Führungsstruktur stets im Dunkeln bleibt, durchgeführten “Longitudinalstudie” zu einem potentiell gefährlichen Subjekt abgestempelt wird, werden er und alle Leute, mit denen er in Kontakt tritt, zu Opfern unerbittlicher Verfolgungen.
Es ist eine perverse Welt, die dieser Text lebhaft vor Augen führt: Alkoholmissbrauch, verstörende Sexualpraktiken, blutige Snuff-Pornos zu Geschäftszeiten. Leute schlafen nackt unter ihren Schreibtischen, im Keller der Agentur sitzen 143 Papageien und lernen einen Werbeslogan (“Miki!”) zu krächzen – und manchmal, manchmal hören Leute einfach auf zu existieren. So mindestens drückt es der korrupte und ekelhafte Agenturchef Adler aus, der den Protagonisten mit “Baby” anspricht, ihn und sich selbst mit Whisky abfüllt und ihm rät, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
“Ein kluger Kopf”, sagt er, “will als erstes keine Dummheiten machen.” Ein Satz, der das Denkverbot treffend zusammenfasst, das den Bürgern dieser dystopischen Gesellschaft auferlegt ist. Wer Fragen stellt, wird bestraft. Überraschende Verhaftungen, Personenkontrollen an jeder Quartiergrenze, seltsam gesichtslose Auftraggeber (alle mit Tiernamen), Zwangsumsiedlungen und Misstrauen gegenüber jeder noch so unscheinbaren Alltäglichkeit bestimmen das Dasein der Leute. Als Gustav Bender von einem “Geheimschutzbeauftragten” namens Bär den Auftrag erhält, in einem sogenannten Single-Wohnhaus den Müll der anderen Bewohner zu durchsuchen, ist er sich bald einmal nicht mehr sicher, ob wirklich nur er und nicht etwa jeder einzelne Bewohner dieses Hauses mit genau diesem Auftrag bedacht sei.
Der ganzen Thematik von der Früherkennung kriminalistischer Aktivitäten durch das Untersuchen des Abfalls, liegt im übrigen eine reale Medienberichterstattung zugrunde. Im Roman arbeiten einige Leute daran aus Medikamenten und einem Stoff, der in Käsepackungen zu finden ist, Sprengstoff herzustellen. Der “Spiegel” berichtete im September 1980 über derartige Vorfälle unter inhaftierten italienischen Rotbrigadisten.
Ist “Weisser Lärm” nun lediglich eine apokalyptische Groteske oder ein sozialpolitischer Alptraum, der näher an der heutigen Realität ist, als uns lieb ist? Mindestens was die technische Komponente betrifft, hat Cueni anno 1981 weise Voraussicht gehabt: elektronische “Wohnzimmersysteme”, “Bildschirmzeitungen” (wenn auch in diesem Fall keine portablen) und die bargeldlose Gesellschaft sind der Realität des 21. Jahrhunderts nah. Was die gesellschaftliche Struktur betrifft, das System totaler Überwachung von oben und alles durchdringender Bürokratie, so sind wir glücklicherweise heutzutage noch einige Schritte davon entfernt – der Diskurs jedoch ist brandaktuell, der “Überwachungsstaat” ein stets am Horizont dräuendes Schreckgespenst. Technische Möglichkeiten und historische Erfahrungen lassen die Erstehung eines derartigen Systems alles andere als unmöglich erscheinen. Auch aus diesem Grunde ist Claude Cuenis zweiter Roman “Weisser Lärm” von grosser Aktualität. Das unlängst vom Schweizer Stimmvolk überraschend deutlich angenommene Nachrichtendienstgesetz lässt grüssen.
In einer Welt, in der keinem Menschen mehr vertraut werden kann, in der die persönliche Freiheit auf ein absolutes Minimum beschränkt ist, in der die letzte und einzige Wärme und Liebenswürdigkeit von einem verspielten kleinen Kätzchen ausgeht, lässt es sich nicht leben. “Weisser Lärm”, dieses erschreckende (und erschreckend gute) Frühwerk von Claude Cueni, fasst den Alptraum in lang nachhallende Worte. “Weisser Lärm” ist nicht nur ein spannendes Zeitdokument. Es ist eine erschütternde Geschichte darüber, wie wenig stichhaltige Argumente es braucht, um eine Person aus der Gesellschaft auszugrenzen, wenn nur genug Drohgebärden und Machtinstrumente aufgeboten werden. Und: Gerade in der heutigen Zeit ist der Text auch eine Mahnung, dass diffuse Ängste, etwa diejenige vor dem “Terror”, nicht das Aufgeben persönlicher Freiheiten befördern sollten – denn dies könnte weitaus schlimmere Folgen nach sich ziehen.
Eine unbedingte Leseempfehlung.
Cueni, Claude. Weisser Lärm. Alptraum vom Grossen Bruder. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch 1983. 144 S. 3-596-22853-0